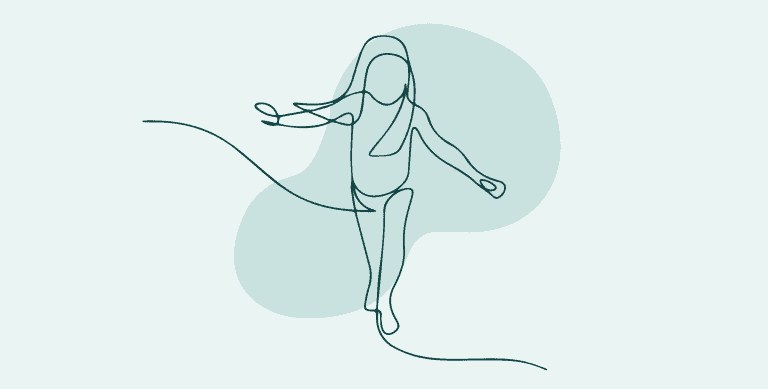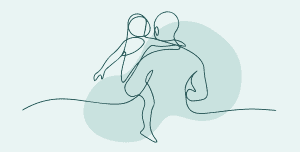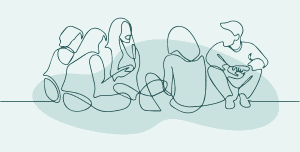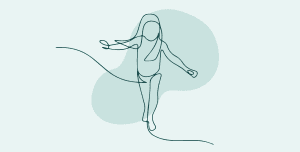Wie war der Tag, als du von dem Tod erfahren hast?
„Jetzt können wir Ihrem Sohn nicht mehr helfen. In 3 bis 4 Stunden wird er hirntot sein. Wie und wann er sterben wird, entscheiden Sie“, sagte die Oberärztin der Kinderintensivstation. Ich erlitt einen Nervenzusammenbruch. Den ersten meines Lebens. Ich schrie so laut, dass mir die Ohren wehtaten.
10 Minuten früher sah alles gut aus. Es ging sogar bergauf. Und nun das? Ich verstand die Welt nicht mehr. Da war so viel Wut, Schmerz, Traurigkeit und vor allem Hilflosigkeit. Ich konnte meinem Sohn nicht helfen, nur noch bei ihm sein und ihn in den Tod begleiten.
Ich hielt stundenlang sein Händchen, wog ihn in meinen Armen, streichelte und küsste ihn. Ich versuchte, diese innige Zeit zu genießen. Schließlich waren das die letzten Stunden, die ich mit ihm verbringen konnte. Ich wollte nicht wahrhaben, dass er im Sterben lag und bald nicht mehr da sein wird. Ich habe ihn doch 9 Monate lang in meinem Bauch getragen und zu Hause alles für ihn vorbereitet. Ich kann doch unmöglich ohne ihn heimfahren.
Was hast du in dieser Zeit gefühlt oder gedacht?
Ich konnte nicht klar denken, stand unter Schock. Eine Krankenschwester schlug vor, noch Hand- und Fußabdrücke von Dominik als Erinnerung zu nehmen. Ich willigte ein. Auch der Taufe stimmte ich zu, obwohl ich all das zum „richtigen“ Zeitpunkt – später – machen wollte. Ein Später gab es aber für meinen Sohn nicht mehr.
Wie hast du ihn in den letzten Stunden vor seinem Tod begleitet?
Es war mir wichtig, die ganze Familie beisammensitzen zu haben, und so ließ ich meine Tochter, die damals 3 Jahre alt war, von meinen Schwiegereltern zur Kinderintensivstation bringen. Und dann saßen wir da: mein Mann mit meiner Tochter auf dem Schoss und ich mit Dominik im Arm. Ein Moment für die Ewigkeit! Könnte man die Zeit stoppen, wäre das der Augenblick gewesen.
Meine Tochter war so stolz, große Schwester zu sein. 5 Tage lang wartete sie, bis sie ihn sehen durfte. Es war ein Hallo und gleichzeitig auch Tschüss. Doch das wusste sie nicht. „Dominik ist so süß“, sagte sie und streichelte ihm sanft über den Kopf. Das war so schön! Leider verging unsere Zeit zu viert viel zu schnell. Meine Tochter musste wieder gehen. Eigentlich hätte sie gar nicht auf die Intensivstation gedurft. Aber in diesem Fall wurde eine Ausnahme genehmigt.
Dominik war ein Kämpfer. Er hielt länger durch, als die Ärzte glaubten, doch irgendwann schwanden seine Kräfte. Die Schwestern stellten nach und nach die Lautstärke an den Überwachungsgeräten der anderen zwei Kinder im Raum aus und dimmten das Licht. Mit diesen kleinen Veränderungen fühlte sich das Klinikzimmer gar nicht mehr so kalt an.
Was ging in den letzten Stunden vor seinem Tod in dir vor?
In den letzten Stunden wankte ich zwischen Hoffnung und Trauer. Ich hoffte auf ein Wunder, wünschte mir, dass irgendetwas passierte und noch alles gut wird. Doch die meiste Zeit weinte ich. Ich trauerte bereits um meinen Sohn, obwohl er warm und weich in meinem Arm lag.
Dann blieb sein Herzchen stehen. Ich wartete, dass es wieder anfing zu schlagen, aber das tat es nicht. Ich war plötzlich eine Sternenkind-Mama und brach zusammen. Da war all die Mutterliebe, die ich Dominik nun nicht mehr schenken konnte, und all der Schmerz, der in meiner Ohnmacht gefangen war. In meinem Buch beschreibe ich diesen Moment so: „Ich schwimme in einem Meer meiner Gefühle und drohe, gnadenlos unterzugehen.“ Ging ich unter? Zum Glück nicht. Mein Mann fing mich auf.
Wie hast du die Zeit bis zur Bestattung erlebt?
Dominik wurde am 3. Tag nach seinem Tod beerdigt. In unserem Bundesland dürfen Tote maximal 4 Tage gekühlt bis zur Beerdigung aufbewahrt werden. Und da wir Dominik weder obduzieren noch verbrennen lassen wollten, musste er innerhalb dieser Frist beerdigt werden. Grausam schnell, wie ich finde.
Die 2 Tage dazwischen erlebte ich wie in Trance. Zum einem, weil ich aufgrund des Not-Kaiserschnitts starke Schmerztabletten nahm, um alle Termine erledigen zu können. Zum anderen, weil ich es einfach nicht begreifen konnte, dass mein heiß geliebter Sohn so plötzlich verstorben war.
Dass das nicht oft vorkommt, merkte ich an den Reaktionen der Menschen, die ebenfalls überfordert waren, sobald ich ihnen von Dominiks Tod erzählte. Kollegen, enge Freunde oder Nachbarn. Selbst der Mitarbeiter des Bestattungsinstituts fragte ungläubig nach und musste schlucken, als er feststellte, dass er sich nicht verhört hatte.
Hast du alle Aufgaben allein erledigt oder hattest du Unterstützung?
Das Bestattungsinstitut übernahm den Großteil der Aufgaben. Sie beantragten die Sterbeurkunde, veranlassten die Überführung unseres Sohnes und koordinierten sogar die Termine mit unserer Pfarrerin. Einen Termin, um ihr unsere Geschichte zu erzählen, damit sie die Trauerrede vorbereiten konnte und einen Termin für die Beerdigung.
Außerdem gab es erste Gespräche mit meiner Hebamme, einer Seelsorgerin und dem Steinmetz. Bei allen Terminen war mein Mann dabei. Auch er hatte sein Kind verloren und trauerte. Gemeinsam stützten wir uns. Auch heute noch (6 Jahre später), wenn es hin und wieder wehtut.
Wie hast du den Tag der Bestattung in Erinnerung?
Am Tag der Bestattung blitzte morgens schon die Sonne hinterm Vorhang hervor. Sie wollte mich aus dem Bett locken. Erst freute ich mich über ihre warmen Strahlen, dann erinnerte ich mich: Mein Sohn ist tot und heute wird er beerdigt. Ich zog mir die Decke über den Kopf, wollte wieder einschlafen und wünschte mir, den Tag einfach zu verschlafen.
Würdest du sagen, die Bestattung war ein wichtiger Schritt für dich, um Abschied zu nehmen?
Im Nachhinein bin ich froh, dass ich nicht im Bett liegen geblieben bin, denn die Bestattung war sehr wichtig für mich und meine Trauerbewältigung. Die Sonne schien den ganzen Tag. Kurz bevor die Pfarrerin eintraf, zeigte das Thermometer 28° Celsius an, Ende September. Um meinen Sohn ein letztes Mal zu sehen und mich zu verabschieden, zog ich dennoch eine Jacke über. Die Aufbahrungsräume sind doch immer kühl. Auf dem Weg dorthin begleiteten mich gemischte Gefühle. Ich freute mich, meinen Sohn noch einmal sehen zu dürfen. Allerdings war es das letzte Mal.
Als die Tür aufging, war es wieder um mich geschehen. Die Ohnmacht und Hilflosigkeit hatten mich voll im Griff. Da lag er, mein Dominik, mein Sohn, mein Bärchen. Er sah aus, als ob er schlief. War er wirklich tot? Ich streichelte und küsste ihn. Er war kalt. Eiskalt! Diese Kälte habe ich gebraucht, um zu begreifen, dass sein Tod endgültig ist. Er würde nicht mehr zurückkommen. Das war mir nun klar.
Was ist dir an der Bestattung positiv in Erinnerung geblieben?
Die Trauerrede war wunderschön. Die Pfarrerin bezog wichtige Details aus Dominiks Geschichte sowie unsere Tochter und ihre Taufe mit ein. Es fühlte sich gut an, auch wenn es gleichzeitig schrecklich wehtat. Und immerzu schien die Sonne. Ihre Strahlen drangen sogar durch die bunten Mosaikfenster hindurch, sodass sich faszinierende Farbspiele auf dem Boden ergaben. Dominik hätte das bestimmt gefallen.
Das Abschiednehmen am Grab war sehr schwer. Das war der allerletzte gemeinsame Weg. Nach dem Fallenlassen der Rose und dem Hinunterrieseln der Erde fing ein neues Kapitel meines Lebens an. Das Leben danach.
Wie hast du die Zeit nach der Beerdigung wahrgenommen?
In den ersten Tagen nach der Beerdigung schwebte ich im Nirgendwo. Täglich begrüßten mich die Ohnmacht, Hilflosigkeit und Ungläubigkeit. Das Leben zog an mir vorbei und ich konnte lediglich zuschauen. Ich fragte mich immer wieder: Wie soll ich nur ohne meinen Sohn weiterleben? Wie soll ich meine Trauer um ihn verarbeiten? Und kann ich je wieder glücklich werden?
Da waren all diese Gefühle und Gedanken, die ich zuvor nie gespürt habe. Sie kreisten permanent in meinen Kopf. Tag für Tag. Nacht für Nacht. Ich fing an, alles aufzuschreiben. Ich versuchte, ein Muster zu erkennen. Meine Erkenntnis: Trauer folgt keinem Muster.
Gab es bestimmte Lichtblicke für dich in dieser Zeit?
Etwa 2 Monate nach dem Tod meines Sohnes begann der Rückbildungskurs, einer für verwaiste Mütter. Unsere Kinder waren alle verstorben, dennoch brauchten auch unsere Körper ein wenig Training. Einmal die Woche fand der Kurs statt und vor den Übungen gab es immer eine Gesprächsrunde. Wir sprachen über unsere Sternenkinder, unsere Trauer und vor allem darüber, wie wir den Alltag ohne unsere Babys bewältigten.
In dieser Runde fühlte ich mich wohl. Hier konnte ich offen reden. Die anderen wollten wirklich wissen, wie es mir geht. Sie waren an meinem Sohn genauso interessiert wie ich an ihren Kindern und ihren Geschichten. Niemand musste sich rechtfertigen. Diese Gruppe, die auch nach dem Ende des Kurses weiterhin bestehen blieb, war neben dem Schreiben meine größte Stütze.
Gab es emotionale Rückschläge? Sind sie in bestimmten Situationen aufgetreten und wie bist du damit umgegangen?
Hochschwangere in meiner direkten Nähe machten mir Angst, frischgeborene Babys konnte ich nicht sehen und die Meldung über schwere Geburten (obwohl am Ende alles gut ging) trafen mich jedes Mal mitten ins Herz. Erst schrieb ich alles nieder, dann besprach ich es mit meinen Mädels aus dem Kurs. Diese Strategie funktionierte gut für mich. Ich stellte mich herausfordernden Situationen, weil ich wusste, dass ich sie schaffen würde. Nur mit Konfrontation würde ich irgendwann wieder positiv nach vorne blicken können.
Ich übte also Alltag, ging wieder arbeiten und unternahm Ausflüge mit meiner Familie. Ich spürte das Leben und ab und zu schlichen sich Glücksgefühle ein. Ich war glücklich, die Zeit mit meinem Sohn gehabt zu haben. Ich durfte ihn kennenlernen, streicheln, küssen, liebhaben. Ich konnte ihn wickeln, ihn füttern und ihm vorsingen. Er war da und diese Zeit konnte mir niemand wegnehmen.
Das Gefühlschaos ging in die nächste Runde. Nach der akuten Phase des Nicht-Begreifen-Wollens habe ich seinen Tod akzeptiert. Nun schwankte ich zwischen den Welten: Ich trauerte der Vergangenheit mit meinem Sohn hinterher und freute mich gleichzeitig auf jeden neuen Tag, den ich weiterhin mit ihm im Herzen erleben durfte. Denn auch ich habe nur ein Leben und diese Not-OP lebend überstanden.
Wie waren die Reaktionen aus deinem Umfeld?
Einst gute Bekannte wechselten die Straßenseite, wenn sie mich sahen. Bloß nicht mit der Frau reden, die ihr Kind beerdigen musste. Doch nicht alle Reaktionen waren derart extrem. Es gab auch einige Freunde und Bekannte, die zugaben, nicht mit unserem Schicksal umgehen zu können. Es blieb somit ruhig, aber ich wusste, woran ich bin. Das war mir immer noch lieber als komplette Stille. Umso mehr half mir das Schreiben. Ich konnte all meine Gedanken rauslassen, die kaum jemand hören wollte.
Je mehr Monate vergingen, desto mehr schwierige Situationen bewältigte ich. Mit jeder einzelnen setzte ich mich auseinander. Ich fand sogar nach und nach den Mut, Menschen, die mir verletzende Sprüche wie „Ihr seid doch noch jung. Bekommt ihr eben noch ein Kind“ oder „Wer weiß, wozu das gut war“ entgegenbrachten, aufzuklären. Anfangs noch unter Tränen, schließlich stellte ich mich jedes Mal meiner eigenen Trauer. Doch irgendwann voller Stolz, denn Dominik war ein toller Junge, der bis zum Ende kämpfte. Er kämpfte, damit ich ihn kennenlernen durfte.
Wie schaust du heute auf alles zurück?
Heute (6 Jahre später) bin ich wieder glücklich. Ich kann mein Leben ohne schlechtes Gewissen genießen. Immer mit Dominik im Herzen. Die Trauer wird nie ganz verschwinden. Besondere Tage wie sein Geburtstag, Todestag oder Weihnachten werden immer wehtun. Aber jedes Jahr ein bisschen weniger.
Was hat dir geholfen, die Trauer zu akzeptieren?
Dominik schenkt mir häufig ein Lächeln – immer, wenn die Sonne scheint. Situationen wie diese haben mir geholfen, meine Trauer zu akzeptieren. Nur weil mein Sohn tot ist, heißt es nicht, dass er aus meinem Leben verschwunden ist. Er hat einfach einen anderen Platz eingenommen. Er ist und bleibt für immer in meinem Herzen und er hat mich gelehrt, was wichtig im Leben ist: Liebe, Familie und Gesundheit. Ich bin sehr dankbar, dass ich seine Mama sein darf.
Was hat dir geholfen, wieder eine Perspektive im Leben zu finden?
Mein Leben hat sich nicht grundlegend verändert, dennoch habe ich mich intensiv mit den Themen Tod, Trauer und Kindsverlust auseinandergesetzt. Ich habe ein Sternenkind-Buch veröffentlicht. Ich erzähle nicht nur meine und Dominiks Geschichte, sondern beschreibe, was ich gefühlt habe – beim Kinderwunsch, der Geburt, den 5 Tagen zwischen Hoffen und Bangen, dem Tod und dem „Leben danach“. Ich möchte Betroffenen Mut machen und ihnen zeigen, dass man wieder positiv in die Zukunft schauen kann, auch wenn einem so etwas Furchtbares passiert ist. Und ich möchte Nicht-Betroffenen zeigen, was sie tun können, um Betroffenen zu helfen. Denn auch sie fühlen sich oft hilflos.
Ich bin außerdem Teil des Sternenbands, dem Erkennungszeichen für Sterneneltern, und engagiere mich im Verein „Unsere Sternenkinder Rhein Main e.V.“. Andere Betroffene in ihrer Trauer zu unterstützen, hilft ungemein.
Hast du einen Rat für jemanden, der gerade eine ähnliche Situation durchlebt?
Mein Rat an jeden Menschen da draußen: Lass die Trauer zu. Als Betroffene aber auch als Nicht-Betroffene. #gemeinsammehrerreichen